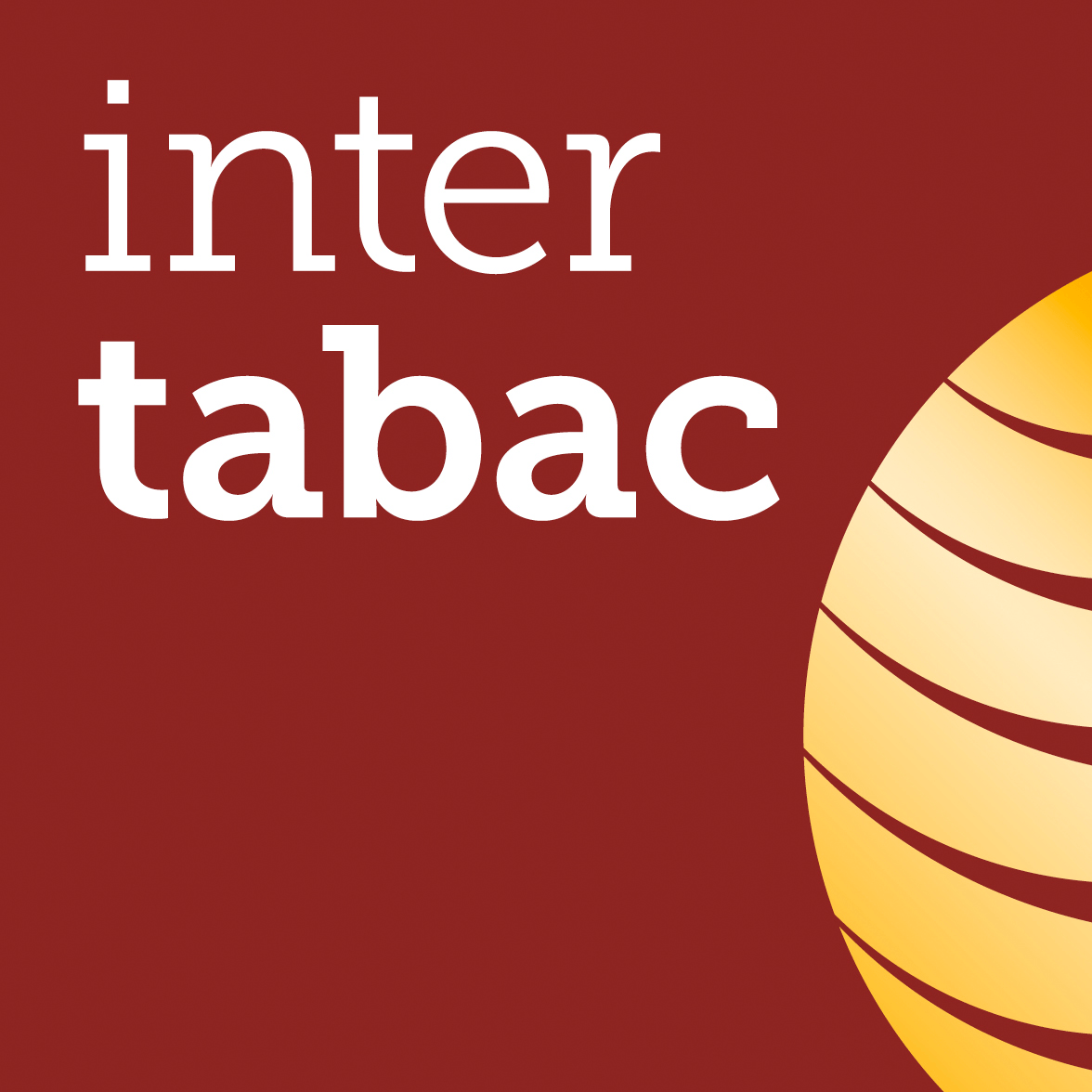Sehnsucht nach dem Normalen
DTZ-Interview mit Torsten Albig von Philip Morris über die aktuelle politische Lage
GRÄFELFING / MAINZ // Torsten Albig, ehemaliger deutscher Politiker, und nun Geschäftsführer External Affairs bei Philip Morris spricht im DTZ-Interview über Politik – im Allgemeinen und rund um das Thema Rauchen. In unserem Gespräch beleuchtet Albig die Rolle des Staates in der Gesundheitsförderung und gibt uns einen Ausblick auf die zukünftige politische Debatte rund um das Thema.
Herr Albig, Sie waren für die SPD-Ministerpräsident und beobachten die politische Situation in Deutschland sicher unverändert aufmerksam. Wie sehen Sie das: Gibt es hierzulande tatsächlich einen Rechtsruck, driften die politischen Seiten immer weiter auseinander oder handelt es sich um gegenseitiges Framing?
Torsten Albig: Angesichts dessen, was nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und weltweit passiert, muss man sagen, dass wir auch in Deutschland eine Normalisierung der politischen Landschaft erleben, in der von ganz rechts bis ganz links alle politischen Akteure im Wettbewerb auftauchen. In Deutschland haben wir die Veränderung später wahrgenommen als in anderen europäischen Staaten wie Frankreich, den Niederlanden, Skandinavien oder Österreich. Wir sind darüber erkennbar aufgeregter, was mit unserer Geschichte und dem deutschen Weg nach den schrecklichen Erfahrungen der Jahre 1933 bis 1945 zu tun hat. Wir haben das Gefühl, jetzt eine besonders gute Demokratie zu sein. Am Ende stellt sich die spannende Frage: Was ist eigentlich die Normalnull einer Gesellschaft? Ist es normal, dass es zwei Volksparteien gibt, beide in der demokratischen Mitte, die sich abwechseln? Oder ist es normal, dass es vier, fünf, sechs Gruppierungen gibt, die alle zwischen 12, 13 und vielleicht 25 Prozent liegen und immer wieder zusammenkommen müssen? Aus Schleswig-Holstein kommend, zeigt ein Blick nach Dänemark, dass es dort politische Gruppierungen gibt, die wir hier bei uns AfD nennen würden, die mal mächtiger, mal weniger bedeutsam waren. Das hängt oft mit der Reaktion der Sozialdemokratie in Dänemark zusammen, oft übrigens auch mit der Migrationspolitik. Die entscheidende Frage ist: Ist das das Tor zur Hölle, das sich öffnet? Oder ist es eine Normalnull, mit dem die demokratische Mitte vernünftig umgehen muss? Wenn die Annahme lautet, dass alles schrecklich ist, wenn wir nicht mindestens 70 Prozent erreichen und zwei große Parteien brauchen, dann werden wir das wahrscheinlich nicht mehr erleben. Wir müssen in der Lage sein, aus den vier, fünf nicht radikalen Parteien handlungsfähige Regierungen zu bilden, möglicherweise um den Preis, dass die nicht zehn Jahre halten, sondern vielleicht auch mal nur zwei Jahre. In Dänemark sind die Haushaltsverhandlungen entscheidend, und dann kippt es auch mal wieder. Man kann dort innerhalb von zehn bis 14 Tagen eine Neuwahl einberufen. Die Plakate haben sie immer im Keller. Trotzdem ist der Staat in Dänemark bislang nicht untergegangen. Wenn wir uns daran herantasten und sagen, dass es kein deutsches Privileg ist, keine Rechtsradikalen mehr zu haben, so wie es auch Linksradikale geben kann, wie in Frankreich, Niederlanden, Dänemark und auch in den USA, dann müssen wir trotzdem Mehrheiten aufbauen. In der deutschen Geschichte ist Weimar daran gescheitert, dass das nicht mehr gelang. Als sie nicht mehr miteinander reden konnten, wurde das Tor zur Hölle geöffnet. In Dänemark gibt es sehr wohl auch Abstimmungen mit der dänischen Volkspartei. Aber wenn die Konservativen, die Sozialdemokraten und die Liberalen in Dänemark gar nicht mehr miteinander reden, dann wird die Luft dünn, wie es in der Weimarer Republik nach dem Tod von Stresemann um 1929 der Fall war.
Wie würden Sie die – aktuelle – politische Mitte definieren?
Albig: Die politische Mitte definiere ich so: Sie bekennt sich zu den Werten des Grundgesetzes und damit zu der besten Verfassung, die es in der Geschichte unseres Landes je gab. Sie bekennt sich auch zu den Grundwerten unserer prägenden Artikel im Grundgesetz, die alle etwas mit Bürgerrechten, Gleichheit, Freiheit und Solidarität zu tun haben. In der Verfassung ist nicht vorgesehen, dass wir ein autoritärer, nationalistischer und das Fremde ablehnender Staat sind, in dem nicht jeder Mensch die gleichen Rechte hat. Darum definiert sich die Mitte. Wenn ich das in Frage stelle, bin ich eindeutig jenseits der Mitte.
Die Wahl liegt beim Erscheinen der DTZ-Ausgabe hinter uns, das Gespräch allerdings haben wir vor dem 23. Februar geführt. Unter dem Gesichtspunkt: Welche Koalitionsmöglichkeiten sehen Sie? Wie könnte aus Ihrer Sicht eine neue Regierung gebildet werden?
Albig: Es hängt jetzt davon ab, wer am nächsten Sonntag wie abschneidet. Wenn ich mir die Hochrechnungen anschaue, spricht vieles dafür, was einen Sozialdemokraten jetzt nicht nur erfreut: Der jetzige Kanzler wird nicht wiedergewählt, und wir haben eine Unionsfraktion, die deutlich die stärkste ist. Zwei kleinere Parteien der Mitte, wie ich sie eben definiert habe, sind in jedem Fall so stark, dass sie mit der Union eine Regierung bilden könnten. Jenseits der Mitte gibt es eine relativ starke Fraktion mit der AfD, vielleicht auch der BSW, und am Rande die Linke oder FDP. Es ist jedoch noch zu früh, um das genau zu sagen, da die letztgenannten Parteien auch die BSW in den Umfragen alle zwischen vier und fünf Prozent liegen. Wenn man den Mitteansatz verfolgt, wäre das Fatale, um das Bild noch einmal aufzugreifen, dass das Tor zur Hölle erst dann geöffnet wird, wenn die, die in Frage kämen, nicht miteinander auskommen. Es müsste für eine schwarz-grüne oder eine schwarz-rote Koalition reichen. Wenn die Parteien jedoch feststellen, dass sie grundsätzlich so verschieden sind oder sich so wenig mögen, weil sie sich im Wahlkampf unnötig persönlich angegriffen haben, wird es sehr schwer. Wenn man den Wählerinnen und Wählern sagt, dass wir so lange wählen, bis das gewünschte Ergebnis herauskommt, ist das noch nie eine erfolgreiche Strategie gewesen. Beim nächsten Mal könnte etwas herauskommen, das nicht mehr in der Mitte den Schwerpunkt hat. Davor kann man nur warnen und sagen, dass sich jeder seiner demokratischen Verantwortung bewusst sein sollte. Was wollen die Leute? Sie wollen eine handlungsfähige Regierung. Was haben die Menschen bei der Ampelregierung am meisten vermisst? Dass sie miteinander Probleme lösen und nicht übereinander herziehen. Völlig egal, ob es objektiv gut oder ob es eine Eins, Zwei, Drei, vielleicht auch mal eine Vier, Fünf oder Sechs war. Objektiv gesehen, von den reinen Fakten her, waren sie gar nicht so schlecht, wie erzählt wird. Die Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind, war jedoch desaströs. Wenn ich den Menschen das zeige, schreie ich förmlich danach, dass die Tür zu einem unangenehmeren Teil unseres Universums sich langsam öffnet. Die Leute sagen dann: „Wenn die es nicht hinkriegen, sollen die anderen es machen.“ In komplexen Zeiten mit verwirrenden Herausforderungen gibt es eine große Sehnsucht nach einfachen Antworten und nach einer starken Führung, die die einfachen Antworten umsetzt. Das ist am Ende das Modell Trump. Bei uns in Deutschland hieß das mal anders, und wir wissen, wie es hieß. Das erleben wir überall. Es hat damit zu tun, dass Menschen überfordert sind. Es überfordert ja auch uns beide. Auch wir stehen manchmal davor und sagen: Du hast den Ukraine-Krieg, eine Energiekrise, globale Erwärmung, und du weißt nicht genau, wie Wachstum in einer solchen Welt aussehen soll. Du weißt auch nicht, ob deine Kinder nicht doch irgendwann eingezogen werden müssen, um zu kämpfen. Dinge, die wir alle ausgeschlossen haben, strömen auf dich ein. Warum sollte ein Herr Scholz oder Herr Merz, bei allem Respekt, die unfassbar schweren Fragen beantworten können? Die Sehnsucht, dass es doch irgendjemanden geben muss, ist natürlich riesengroß. Man bemerke immer erst, dass die Erwartung, dass das auch stimmt, was behauptet wurde, vollkommen abwegig sind, wenn sie dann an der Macht kommen. Auch das haben wir in Deutschland schmerzhaft erlebt, und andere erleben das gerade auch, wie die Amerikaner. Wir sehen, wie jemand, der überhaupt keine politische Legitimation hat, die Exekutive schreddert. Das geht sehr schnell, und dann wacht man auf und das Land ist ein anderes. Noch einmal: Was auch immer das Ergebnis sein wird, ab dem 24. oder quasi ab der Veröffentlichung unseres Interviews, sollten sich alle verdammt noch mal bewusst sein, dass ganz Europa auf uns schaut. Wenn Deutschland, das auch nicht hinbekommt wie Österreich, ist das kein gutes Zeichen für den Kontinent.
Und wann ist es so weit, dass die neuen Minister und ein neuer Bundeskanzler vereidigt werden?
Albig: Das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel, aber nach meinen Erfahrungen muss ich sagen: Sie brauchen jetzt etwa eine Woche, um sich zu sortieren. Dann beginnen die Sondierungsgespräche, die in der Konstellation zwei bis vier Wochen dauern könnten. Anschließend starten die Koalitionsverhandlungen, die eher vier Wochen in Anspruch nehmen. So sind wir im März, Ende April. Kurz nach Ostern oder Anfang Mai, irgendwie so. Viel früher würde ich nicht damit rechnen.
Beim Betrachten der politischen Gemengelage drängt sich der Eindruck auf, dass die Ampel – beziehungsweise Rot/Grün – die Probleme der Menschen im Land entweder nicht erkennen oder sie nicht ernst nehmen. Was muss sich aus Ihrer Sicht in der kommenden Legislaturperiode ändern?
Albig: Tatsächlich würde ich nicht unterschreiben, dass sie die Probleme nicht erkannt oder nicht ernst genommen haben. Sie konnten jedoch nicht vermitteln, dass sie das tun. Durch ihre Art der Kommunikation haben sie das Gegenteil vermittelt. Schauen wir uns den Umgang mit der Erdgasversorgung zu Beginn des Ukraine-Krieges an. Die gefundene Lösung, die natürlich zu einer Verteuerung des Rohstoffs geführt hat, war objektiv eine der besten in ganz Europa, wahrscheinlich sogar die beste. Das war keineswegs das Versagen von Herrn Habeck, und manche der Kritiken waren fast absurd. Trotzdem haben sie es geschafft, den Menschen zu vermitteln, dass andere Themen so wichtig genommen wurden, dass man sich ständig darüber gestritten hat. Die Leute haben sich in ihrem Führungspersonal nicht wiedergefunden. Damit sind wir bei grundlegenden Fragen, die man in einem Unternehmen genauso findet wie in der großen Politik. Führen bedeutet auch kommunizieren. Wenn man meint, führen bedeutet nur, man marschiere voran und alle folgen gefälligst, dann wird man abgewählt, genauso wie man irgendwann als CEO verschwindet. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ich befürchte, der gestrige Kanzler wird es deswegen heute nicht mehr sein.
Nicht zuletzt aus den Reihen der Wirtschaft kam deutliche Kritik an der Bundesregierung. Welcher drei Themen muss sich ein neuer Wirtschaftsminister mit Vorrang annehmen?
Albig: Wachstum, Wachstum und Wachstum. Deutschland muss die treibende Kraft in Europa sein. Wir erleben eine USA, die uns nicht mehr freundlich gesinnt ist, und ein China, das kein Interesse daran hat, dass es uns gut geht. Die Zeiten, in denen andere Länder verlängerte Werkbänke für uns waren, sind vorbei, aber das hat noch nicht jeder verstanden. Die Autos, die aus China kommen, sind mittlerweile so hochwertig, dass unsere Hersteller sich massiv anstrengen müssen. Die Amerikaner haben keine Scheu, einen Handelskrieg nach dem anderen auszulösen. Wenn wir dann auch noch durch eine wachstumsfeindliche Wirtschaftspolitik eine Rezession fördern, werden wir zwischen den beiden Mächten zerrieben. Denn wenn Deutschland nicht funktioniert, funktioniert der Rest von Europa nicht, ohne irgendeinem Nachbarn zu nahe treten zu wollen. Die Wirtschaftspolitik muss Wachstumsimpulse freisetzen, und das muss im konstruktiven Dialog der Koalitionspartner im Mittelpunkt stehen. Was der richtige Schlüssel dafür ist, hängt von der politischen Ausrichtung ab. Ein Konservativer würde andere Antworten geben als ich. Wichtig ist, dass neben dem was entschieden wird, ein Großteil des wirtschaftlichen Erfolgs auch von der Psychologie abhängt. Egal, ob es sich um eine Steuersenkung, Deregulierung oder Wachstumsprogramme handelt – wenn die Regierung etwas entscheidet und am nächsten Tag der Koalitionspartner darüber herfällt, wird alles, was aufgebaut wurde, wieder zerstört. Dafür haben wir keine Zeit.
Wenn wir mit Kraft vorangehen und in Europa wieder eine Führungsrolle übernehmen, auch wirtschaftspolitisch, habe ich keinen Zweifel, dass wir erfolgreich sein werden. Trotz aller Kritik ist Europa und Deutschland bildungspolitisch und ausbildungspolitisch weit vor den USA. Unsere Innovationskraft und unser Wissen sind beeindruckend, auch wenn wir keine großen IT-Konzerne haben. Europa und Deutschland müssen sich nicht verstecken. Unser Mittelstand ist stark, und die Politik muss das vermitteln und Mut machen. Vielleicht brauchen wir jetzt ein paar Jahre mehr Vertrauen, dass wir die Dinge richtig machen. Es ist gerade nicht die Zeit für zusätzliche Regulierungen, für Überlegungen nach noch einem Lieferkettengesetz. Die Erwartung, dass wir alle Lumpen sind, hilft uns nicht weiter und ist zudem auch falsch.
Immer wieder wird zudem geäußert, der Staat greife zu sehr in die Belange der Bürger ein. Da geht es natürlich auch ums Rauchen, Dampfen oder um den Konsum von erhitztem Tabak. Wie beurteilen Sie das?
Albig: Ich frage mich immer, wie die Balance zwischen staatlichem Eingreifen und individueller Freiheit aussehen sollte. Einerseits muss der Staat gegen missbräuchliche Entwicklungen vorgehen, die der Gesellschaft schaden und hohe Kosten verursachen. Andererseits sollten Bürger auch die Freiheit haben, eigene Entscheidungen zu treffen, selbst wenn diese nicht immer gesund sind. Sei es eine Fertigpizza, Zucker im Kaffee, salzige Eier oder der Konsum von Nikotin – jeder sollte die Möglichkeit haben, solche Entscheidungen für sich zu treffen. Wer die Balance nicht findet und glaubt, der Staat müsse wie ein überwachendes Kindermädchen agieren, treibt die Menschen in den Widerstand. Menschen können sehr gut selbst entscheiden. In Schweden sehen wir eindrucksvoll, dass weniger als fünf Prozent der Menschen rauchen, weil sie Alternativen wie Nikotinbeutel nutzen. Die bieten den gewünschten Effekt von Nikotin, ohne die krebserregenden Stoffe, die bei der Verbrennung von Zigaretten entstehen. Das Ergebnis: 40 Prozent geringere Lungenkrebsrate bei schwedischen Männern im Vergleich zum Rest Europas. Aus der Sicht eines Nanny Staates ist das vielleicht nicht ideal, weil die Menschen noch süchtig sind. Aber aus der Sicht einer Gesellschaft, die auf die Klugheit ihrer Bürger setzt, gemessen an dem, was sie vorher gemacht haben, über 20 Prozent der Schweden haben geraucht, ist das eine gute Entwicklung. Wenn jemand täglich 60 Zigaretten raucht, sollte der Staat mit dem Arzt intervenieren, weil dies neben den fatalen gesundheitlichen Konsequenzen, zu teuren medizinischen Behandlungen führt. Aber wenn jemand Nikotin über Nikotinbeutel, E-Zigaretten oder Erhitzer konsumiert, die im Durchschnitt weniger als 95 Prozent der Schadstoffe freisetzten und nur gelegentlich eine Zigarette raucht, sollte das den Menschen überlassen bleiben. Das gilt auch für die Frage, ob in Biergärten geraucht werden darf. Da wäre mein schlichter Rat als früherer Politiker, solche Regelungen sind schwer zu kontrollieren und führen nur dazu, dass Menschen sich gegenseitig anschwärzen. So eine Welt wollen wir nicht haben. Stattdessen sollte sich der Staat auf die wirklichen Extreme konzentrieren, wie den Zugang von 15-Jährigen zu verbotenen Produkten. Eine klare Regulierung, die Nikotinbeutel als Tabakprodukte behandelt und sie mit Alterskontrollen ordentlich verkauft, würde viele Probleme lösen. Der Staat behauptet, er schütze die Menschen, tut es aber nicht wirklich. Wir haben eine so schlechte Regulierung, dass wir sie irgendwie verbieten, aber irgendwie dann auch nicht. Meine eigenen Kinder kannten Nikotinbeutel, bevor ich davon wusste, und nutzten sie in einem Alter, das ich als Vater nicht gutheiße. Das ist keine gute staatliche Regulierung. Wir brauchen mehr Vertrauen in die Menschen. Die Übergriffigkeit muss man beenden und wenn reguliert wird, dann sollte es so klug sein, dass es auch funktioniert.
Mit einer neuen Regierung dürfte auch ein neuer Drogenbeauftragter ernannt werden. Was sind Ihre Erwartungen, Ihre Forderungen an den neuen Amtsinhaber?
Albig: Das schließt genau an meine Antwort zu Ihrer letzten Frage an. Ich biete einen konstruktiven Dialog mit der Industrie an, auch wenn das für viele in der Politik auf den ersten Blick komisch klingt. Die Industrie hat kein Interesse daran, weil es unsere Reputation beschädigt, dass Menschen, von denen wir nicht wollen, dass sie Zugang zu Nikotin haben, durch eine schlechte Regulierung praktisch doch alle Zugänge dazu haben. Wir haben ein Interesse an Vereinbarungen, wie man das besser und härter machen kann. Wir wollen nicht, dass es Einweg-E-Zigaretten gibt. Das muss aber der Staat verhindern, und wir folgen dem Weg. Wir wollen nicht, dass es hunderte von Geschmacksrichtungen gibt. Das kann ein Staat verhindern. Erwachsene Menschen brauchen, um einen Geschmack im Mund zu haben, so etwas wie Menthol oder Spear Mint, wie es in Amerika von der FDA geprüft wurde. Aber es braucht kein Himbeer-, Cola- oder Waldmeistergeschmack. Das ist alles nicht notwendig. Das kann man regulieren, und wir folgen dem. Dazu gehört aber, dass wir miteinander in den Dialog kommen. Die letzte Regierung, und da ist sie aus meiner Sicht sehr wohl zu kritisieren, hat sich dem Dialog komplett verweigert. Dadurch hat sie auch nicht gesehen, wie bei den Nikotinbeuteln, in welche Falle sie gerade läuft, dass sie nur scheinbar reguliert. Tatsächlich haben wir den größten europäischen Markt für Nikotinbeutel in Deutschland. Keiner hat was davon, die Industrie nicht, der Einzelhandel nicht, der Staat hat keine Tabaksteuer, und junge Leute haben unbegrenzten Zugang zu dem Produkt. Das ist töricht. Wir hätten gern einen Drogenbeauftragten, der das nicht nur als Titel trägt, sondern sagt: Ja, wenn wir das wollen, lasst uns an einen runden Tisch sitzen. Es geht nicht darum, unser Ergebnis besser zu machen. Aber wir haben viele Ideen, wie wir ein gutes Ergebnis erzielen können, ohne dass junge Leute beteiligt sind. Wir haben gute Ideen, wie wir es erreichen können, dass Hardcore-Raucher in Deutschland, die alle irgendwann an Krebs erkranken werden, noch auf andere Produkte umsteigen können, auch wenn die weiter die Sucht aufrechterhalten. Wir glauben jedoch, dass viele der Raucher, in der Realität davon nicht wegkommen werden. Ein Großteil, werden nicht mehr aufhören, wenn sie seit 20 Jahren rauchen. Viele von ihnen schaffen das nicht oder wollen das auch nicht. Aber wie in Schweden könnten wir sie umleiten. Wenn wir in den vergangenen 20 bis 30 Jahren ein Nikotinprodukt haben, das nicht so schädlich ist, könnte das für sie ein Ausweg aus der aktuellen Situation sein. Die europäische Antikrebsstrategie ist ein großes Ziel der Europäischen Kommission. Es gibt kein Grundgesetz, das besagt, dass nur Schweden das erreichen kann. Ich sage Ihnen und auch dem neuen Drogenbeauftragten: Wir miteinander, Sie alleine nicht, aber wir miteinander können auch Deutschland wie Schweden rauchfrei machen und damit Lungenkrebs in Deutschland genauso zurückdrängen wie in Schweden. Dann müssen Sie es politisch noch hinbekommen, dass Sie das als Erfolg und nicht als Misserfolg sehen. Wenn Sie es im nächsten Schritt dann noch schaffen, Menschen davon zu überzeugen, anstatt Nikotin Mineralwasser zu sich nehmen, werde ich applaudieren. Allerdings werde ich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr bei Philip Morris sein, weil es dafür sicherlich sehr lange brauchen wird. Auch hier gilt, die Zeit haben wir nicht.
Eine persönliche Frage zum Schluss: In der politischen Situation in Deutschland tut sich so viel wie lange nicht mehr. Bedauern Sie Ihren Rückzug? Juckt es Sie nicht manchmal, sich wieder stärker einzubringen?
Albig: Es wäre merkwürdig, wenn es nicht jucken würde. Es ist, als ob man Fußballer fragt, warum sie das Tor nicht treffen. Man selbst hat es ein paar Mal geschafft, aber auch ich habe einige Male danebengeschossen. Ich weiß, wie schwer das Spiel ist und wie leicht es von außen zu beurteilen ist, aber wie schwierig es ist, wenn man mittendrin steckt. Was sich in meinem Leben wirklich verbessert hat und mir noch bewusster wurde, als meine politische Karriere endete, ist, wie hart es ist, eine öffentliche Person zu sein. Ich genieße es zutiefst, keine öffentliche Person mehr zu sein. Wenn mir jemand sagen würde, ich könnte morgen Kanzler werden, aber dann wäre meine gesamte Privatheit dahin, würde ich jetzt sagen: Nein, das möchte ich weder für mich noch für alle Menschen, die ich liebe und die um mich herum sind. Denn das betrifft uns alle, und die Welt ist sehr gnadenlos. Interviews wie dieses kann ich immer noch ab und zu geben, und dabei fühle ich mich jetzt besser als in der politischen Welt. Auch wenn ich sicherlich bei der einen oder anderen Beratung für einen Kanzler, wie man sich in den drei Jahren kommunikativ noch besser aufstellen könnte, den einen oder anderen guten Rat hätte geben können. Das war jetzt nicht gefragt, und das ist auch okay.
Aber jeden Morgen, ohne die Angst aufzuwachen, dass meine Tochter in der Zeitung liest, was für ein Idiot ihr Vater ist, das können sich die meisten Menschen nur schwer vorstellen. Die Angst habe ich nicht mehr. Also, lange Rede kurzer Sinn: Nein, ich bin sehr zufrieden mit dem Zustand, den ich jetzt habe.
Herr Albig, herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte
DTZ-Chefredakteur Marc Reisner
InterTabac &
InterSupply
sind Messen der
Messe Dortmund GmbH
Strobelallee 45
44139 Dortmund
Telefon +49 (0) 231 1204-521
Telefax +49 (0) 231 1204-678